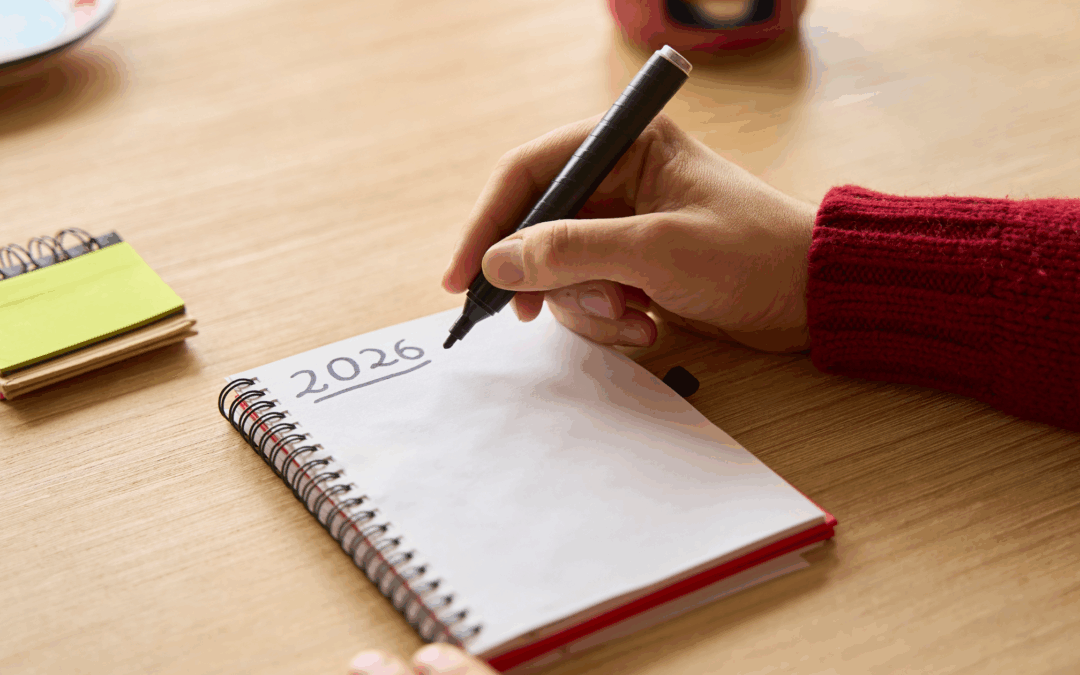
von Kerstin Bamminger | Jan. 28, 2026 | Allgemein, Leben, Paarbeziehung
Warum Neujahrsvorsätze deiner Beziehung oft nicht helfen – und was stattdessen wirklich zählt
Neujahrsvorsätze klingen nach Aufbruch – und landen oft im Frust. In diesem Blog erfährst du, warum echte Veränderung in Beziehungen anders beginnt: mit ehrlichem Bewusstsein, kleinen Ritualen und echter Verbundenheit. Für ein Jahr, das wirklich zählt.
Es ist Ende Jänner und die ersten gut gemeinten Neujahrsvorsätze sterben bereits vor sich hin. Nicht bei mir, denn ich hatte heuer keine. Obwohl ich einige Jahre tolle, belebende und erfüllende Vorsätze feierte – dieses Jahr fühle ich es nicht. Was nicht bedeutet, dass ich keine Ziele hab. Natürlich ist der Jahreswechsel eine wunderbare Gelegenheit, mit neuen Gewohnheiten, Gedanken und Grundhaltungen durchzustarten. Doch jeder andere Tag ist dazu mindestens genau so geeignet.
Warum Neujahrsvorsätze so häufig scheitern
Das Problem ist: die meisten Vorsätze basieren auf Mangel und Schuld. Wenn wir uns Dinge vornehmen, dann weil wir die Idee haben, da sollte etwas anders sein – oft sehr am Außen orientiert. Das hat manchmal recht wenig mit unseren echten Bedürfnissen zu tun. Ein Beispiel: ich nehme mir als Paar vor, einmal im Monat ein spektakuläres Date zu veranstalten, weil das auf Instagram udn Co immer so romantisch aussieht. Eigentlich bin ich aber der Typ „kuschelt sich lieber zuhause ein“ oder eine nette Waldrunde mit dir gibt mir mehr – dann wird‘s schwierig. Wir sollten uns eher an unseren ehrlichen Bedürfnissen orientieren, statt aus Schuldgefühlen oder Optimeirungsdrang heraus zu handeln.
Was noch problematisch ist: das limbische System liebt Gewohnheiten. Es soll am besten alles so bleiben, wie es immer war – das kostet die wenigste Energie. Jede kleine Veränderung kann also inneren Widerstand erzeugen. Dagegen aufstehen kostet uns oft so viel Energie und Nerven, dass wir‘s bald bleiben lassen.
Besonders im Hinblick auf Beziehungen sei noch gesagt: ein Vorsatz allein (und von einer Person) ändert nicht das gesamte System. Du kannst deinen Teil zum Gelingen beitragen, bist aber nicht allein dafür verantwortlich, dass es gut wird. Zu einer Partnerschaft gehören nämlich mindestens zwei. Eine bewusste Entscheidung, wieder mehr für das eigene Glück, die Zufriedenheit und die Harmonie zu tun, ist trotzdem ein guter Anfang.
Ob mir das gelingt? Ganz ehrlich – auch nicht immer. Auch hier sind verschiedenste schöne Pläne schon in Schubladen versumpert, attraktive Vorhaben nie umgesetzt worden und gemeinsam angestrebte Ziele nicht erreicht. Doch auf welchen drei Säulen meiner Erfahrung nach echte Veränderung in Beziehungen passieren kann, möchte ich hier festhalten
Die 3 Säulen für echte Veränderung in Beziehungen
1. Bewusstsein
Die Voraussetzung, etwas anders machen zu wollen, ist die Erkenntnis, dass etwas für mich nicht mehr stimmig ist oder ich mir etwas anderes wünsche. Was wir seit Jahren rund um Neujahr zelebrieren (oft direkt nach dem Neujahrswalzer um Mitternacht) ist, uns zu fragen: „Was möchten wir in diesem Jahr miteinander erleben? Worauf freuen wir uns?“ Das lenkt die Gedanken gleich in eine positive Richtung und schafft eine verbindende Energie. Wir reden über gesundheitliche, berufliche, sportliche Ziele – viele Paare reden aber selten über Beziehungsziele. Dabei könnten wir damit so schön die Segel setzen.
2. Mikro-Routinen
Ich bewundere manche Paare wirklich für ihre Kreativität beim Daten. Jeden Monat ein anderer kreativer Einfall, teils mit viel Aufwand verbundene Aktivitäten oder romantisch verbrachte Paarzeit. Wenn es nicht nur für die Show auf sozialen Medien gemacht wird, kann ein besonderes Date eine unglaublich verbindende, positive und beglückende Sache sein.
Wenn du merkst: dafür ist in unserer Lebensphase aber kaum Zeit und Raum, uns fehlen die Ressourcen und wir möchten dennoch in uns inviestieren, dann helfen dir vielleicht folgende kleinen Routinen udn Rituale:
- Tägliche 5-Minuten-Frage: „Was hat dich heute berührt?“
- Sonntagabend-Check-in: „Was war diese Woche gut zwischen uns?
- 20 Sekunden Umarmung (in der Früh / am Abend)
- Ein 6-Sekunden Kuss (reicht, um Oxytoxin Ausschüttung anzukurbeln – das Liebeshormon)
- Eine ehrliche Wertschätzung geben, etwas Konkretes, das ich heute beobachtet hab
- Initiative: „Was kann ich dir heute abnehmen, um dich zu entlasten?“
- eine Mini-Aufmerksamkeit verschenken (Post-it Zettel mit Botschaft, deine Lieblingsschokolade oder die Sportzeitschrift, die du gern hast)
3. Verbundenheit
Es tut mir beinah weh, das zu schreiben, aber: Disney und Hollywood tun uns keinen Gefallen mit den Liebesgeschichten, die sie erzählen. Wir haben sehr verklärte und – noch schlimmer – unausgesprochene Visionen und Träume davon, wie Beziehungen und Liebe aussehen sollten. Wenig davon hält der Realität stand.
Liebe ist nicht nur ein Gefühl. Viel mehr ist es ein TUN-Wort. Beziehungsglück fällt nicht im günstigen Schicksalsmoment auf uns herab – viel mehr ist es ein tägliches Ja zueinander, ein Annehmen, ein Mild-sein miteinander. Dauerhafte Verbundenheit und Zufriedenheit ist kein Zufall, sondern die Entscheidung immer wieder und immer weiter aneinander, miteinander und füreinander zu wachsen. Oft so weit außerhalb unserer Komfortzonen, dass es richtig unbequem wird.
Beziehungsarbeit als Jahresreise – nicht als Sprint
Traditionell ist der Jänner – nach Weihnachten und Jahreswechsel – beraterische Hochsaison. Viele Paare, wo es schon nicht mehr so gut läuft, retten sich irgendwie über die Feiertage und fassen dann mit dem Glockenschlag der Pummerin den Entschluss: so kann‘s nicht weiter gehen.
Als psychologische Beraterin möchte ich sagen: Beziehung ist wie ein Garten. Er braucht das ganze Jahr über Pflege, es gibt winterliche Phasen wo alles brach liegt und unter einer dicken Eisdecke verschollen scheint bevor es wieder zum Aufblühen kommt. Jahreszeiten in Beziehungen sind völlig natürlich – niemand erlebt dauerhaften Liebes-Hochsommer. (Das würden wir auch gar nicht aushalten.)
Doch von schönen Plänen, guten Vorsätzen und tollen Ideen entsteht noch kein Garten. Es braucht das Pflanzen von Samen, unser Gießen und Vertrauen, dass es Zeit braucht, bis wir die Früchte ernten können. Wir dürfen die Hände in den Dreck stecken und uns anstrengen, dann freuen wir uns auch deutlich mehr über das, was wächst und wir irgendwann ernten dürfen.
Und manchmach darf auch etwas sterben. Nicht jede Entwicklung ist mit jedem Menschen möglich. Manchmal wurde zu lang auf das Pflegen vergessen – da kommt jede gute Gießkanne zu spät. Das ist natürlich meist traurig und ernüchternd, schmerzt und erschüttert oft das gesamte Umfeld – doch besser etwas Fauliges in den Kompost geben und zu etwas Gutem verwandeln lassen, als alles umliegende auch noch damit zu zerstören.
Vom Wissen ins Tun kommen.
So will ich dir an dieser Stelle Mut machen. Du brauchst keinen perfekten Plan. Nur den ersten Schritt. Auch ein verwilderter Beziehungs-Garten kann zu neuem Leben erwachen und schön werden, wenn man mal weiß:
- WIE wollen wir das denn haben – unsere Partnerschaft?
- WAS finden wir schön miteinander und aneinander?
- WAS bin ich bereit, dieses Jahr zum Gelingen dieser Verbindung beizutragen?
Und dann geh, und setzte um. Die großen Vorhaben – und besonders die klitzekleine, die jeden Tag Platz haben. Weil sie nix kosten und kaum Zeit verlangen. Vielleicht bemerkst du die Veränderung nicht gleich beim ersten Mal. Doch verlasse dich drauf: wie in einem Garten wird sich Wachstum und Entwicklung zeigen. Es wird sich verändern – weil du etwas anders machst. Und wenn dein Gegenüber auch motiviert ist, habt ihr doppelte Schubkraft.
Dann steht einem geglückten Jahr in beziehungstechnischer Hinsicht praktisch nix mehr im Wege. Schon gar nicht die nicht gefassten Neujahrsvorsätze.
Wenn du dir schon länger vornimmst, deiner Beziehung mit professioneller Begleitung neue Ausrichtung und Aufrichtung zu gönnen, dann hol dir jetzt deinen kostenlosen und unverbindlichen ERSTGESPRÄCHstermin.
Allein ist es oft sehr viel mühsamer, die angestrebten Veränderungen in die Umsetzung zu bringen, Missverständnisse und alte Konflitke säumen den Weg und ihr wünscht euch dringend neuen Input?
Lass uns darüber plaudern, wie eine individuelle Begleitung eurer Paarbeziehung aussehen kann, was das kostet, was ihr erreichen wollt und was ich dazu beitragen kann. Du hast nix zu verlieren – außer …

von Kerstin Bamminger | Dez. 23, 2025 | Leben, Allgemein
Mein Kopf explodiert beinahe, wenn ich mir am Ende dieses Jahres zu Gemüte führe, was alles in diese letzten zwölf Monate gepasst hat. Ich könnte einen Roman darüber schreiben, was sich businessmäßig getan hat – vieles davon hinter den Kulissen –, was ich in meiner Arbeit mit Klient:innen gelernt habe und was sich persönlich bei mir getan hat, lässt sich ohnehin kaum in Worte fassen.
2025 kam im Gewand eines unaufgeregten Jahres daher. Und hatte es dann doch ganz schön in sich.
Heute teile ich mit dir zwölf Lektionen aus diesem Jahr. Und wie sollte es anders sein: Es geht um Beziehungen. Um Nähe, Verantwortung, Grenzen, Loslassen und darum, wie viel Arbeit und Schönheit darin liegen.
JÄNNER-Lektion: „Lerne, Räume voller Möglichkeiten besser zu nutzen.“
Bei meinem Impulsvortrag leistete ich mir einen erstaunlichen Fehler. Das Haus war voll mit „Frau in der Wirtschaft“, ich war begeistert bei der Sache und schwärmte für Beziehungen in jedem erdenklichen Kontext.
Und am Ende? Vergebe ich meine Chance zu pitchen. Keine Einladung, kein Hinweis auf meine Dienstleistung. Einfach ausgelassen.
Eine verpasste Gelegenheit, über die ich mich später noch grün und blau geärgert habe. Auch das ist Lernen.
FEBRUAR-Lektion: „Arbeite mit den Eltern, bevor du die Kinder angreifst.“
Wenn Erwachsene in der Beratung aufschlagen, die gern ihr Kind „repariert haben möchten“ (genau so sagen sie das nicht, aber in der Hoffnung), bin ich seit jeher skeptisch. Heuer hab ich mich wieder einmal darauf eingelassen und zu früh zugestimmt, dass das Kind mitkommt in die Beratung. Mir wurde bewusst, dass das Kind alles richtig macht und die Eltern das eigentliche Problem sind. Ich hab gerettet, was zu retten war, und das junge Mädel bestärkt, was das Zeug hält. Die Eltern hab ich dabei wohl verloren – sie kamen danach nicht wieder.
MÄRZ-Lektion: „Kümmere dich um dich selbst, sonst macht es niemand.“
Mein Terminkalender explodierte im März regelrecht, weil ich verabsäumt hatte, die automatisierten Buchungen einzuteilen. Freie Blöcke waren dann Mangelware und manchmal ging es nach einem vollen Beratungstag abends noch für drei Stunden Workshops in die Elternbildung. Ich hab sehr viel Energie, aber das war dann doch selbst mir zu steil. Da ging auch meine Routine verloren, jeden Tag eine Runde im Wald zu drehen. Lektion gelernt.
APRIL-Lektion: „Eine einzige Person kann eine ganze Gruppe vergiften.“
Innerhalb von zwei Monaten halte ich zehn Partnerkurse für Brautpaare. Ein Seminar, das mir grundsätzlich unfassbar viel Freude bereitet. In einer Gruppe saß Anfang April ein Mann, der mir gründlich in die Suppe spuckte. Es ist nicht zu glauben, wie passiv-aggressiv man sich mit Körpersprache, Mimik und einsilbigen Wortmeldungen zum Gift einer Gruppe machen kann. Erst am Nachmittag zog ich eine deutliche Grenze und wies den guten Mann in verbale Schranken. Dieser Tag kostete mich so viel Kraft wie alle anderen Kurse zusammen. Ich schüttle immer noch den Kopf über so dummes und kindliches Verhalten und erkenne leider an: Eine Person reicht, um das soziale Klima einer ganzen Gruppe zu vergiften.
MAI-Lektion: „Beziehungsarbeit ist ein Knochenjob. Auch nach 20 Jahren.“
Ein Konflikt in der Paarbeziehung bricht im öffentlichen Raum vom Zaun, und vor den Augen vieler anderer geraten wir in ein Wortgefecht, das mich an den Rand der Verzweiflung treibt. Die Aufarbeitung dieser emotionalen Achterbahnfahrt hat mich enorme Kraft gekostet. Ich hab noch nie einen Hehl daraus gemacht, dass wir als Paar genauso unsere Kämpfe auszutragen haben wie andere. Was wir aber klugerweise schon können: uns in solchen Krisen professionelle Hilfe holen.
Geht’s dann locker-lässig? Nein, es bleibt teilweise echt harte Arbeit. Aber es ist eine große Entlastung, eine neutrale, emotional unbeteiligte Person dabei zu haben, die hilft, durch den Nebel zu manövrieren.
JUNI-Lektion: „Gib ihnen Wurzeln. Und dann gib ihnen Flügel.“
Unsere Mittlere meistert mit Bravour ihre Matura, und ich stehe als Mama mit Tränen und voller Stolz daneben und beobachte, wie sie ihr Leben jeden Tag mehr selbst in die Hand nimmt. Ich gebe das zweite Lebensbüchlein aus der Hand, das ich für jedes meiner Kinder geschrieben hab, und damit ihr ihre Lebensgeschichte. Ein bewegender Moment. Ich liebe alles daran, große Kinder zu haben. Was aber immer noch ist – wie mit kleinen Kindern –: die Gleichzeitigkeit so vieler unterschiedlicher Gefühle. Sie machen mich lebendig.
JULI „Geteilte Freude ist doppelte Freude. Oder noch mehr.“
Beruflich starre ich in ein beschissen großes Sommerloch. Dafür hab ich Zeit, mich mit Haut und Haaren in die Arbeit um das Geburtstagsvideo meiner jüngsten Schwester zu werfen. Wie mag ich ihre Geschichte erzählen, wie verpacke ich Botschaften und kleine geheime Infos in Musik und Bildern – wie kann ich vermitteln, was für eine großartige Persönlichkeit sie ist? Zwei Tage komme ich aus dem Pyjama nicht mal raus, weil ich so im Workflow bin und einfach die allergrößte Freude hab, jemandem so eine Überraschung zu bereiten. (Und ja, sie hat alle Easter Eggs entdeckt und gefeiert und wertgeschätzt. Hurra!)
AUGUST „Die Liebe ist immer für Überraschungen gut.“
Völlig überarbeitet, aber ohne wirklich gut abgeschaltet zu haben, ging es im August gen Süden. Zum ersten Mal ein Sommerurlaub nur zu zweit, ohne Kinder. Nach zwanzig Jahren Ehe haben wir uns selbst überrascht, wie sehr wir diesen Urlaub für uns genießen konnten. Wir haben uns so richtig wiedergefunden und unsere starke Verbindung zueinander zu neuem Leben erweckt. Der Alltag ist ein verrücktes Spiel und gefährlich kräftezehrend. Wir haben uns in Portugal geschworen: Dieses neue Level an Qualität in der Beziehung geben wir nicht mehr her.
SEPTEMBER „Schönheit, Wert und Zerbrechlichkeit – Porzellan soll gefeiert werden.“
Selten hab ich ein Ehejubiläum so gefühlt wie die Porzellanhochzeit. Mitten im Trubel der Feierlichkeiten haben wir unserer Toni tatsächlich Flügel verliehen und sie in ihr Au-pair-Abenteuer verabschiedet. Ich hab noch immer kein Wort für das Gefühl an dem Bahnsteig. Es war irgendwas zwischen Begeisterung, Stolz und Ohnmacht. Ich hab’s schon länger geahnt, und nach und nach erlebe ich es: Die eigenen Kinder tatsächlich loszulassen ist wohl die größte und herausforderndste elterliche Übung.
OKTOBER „Integrität ist mehr wert und wichtiger als das offene Honorar.“
Mitten in einer Paarberatung hab ich scharfe Kritik an einem zukünftigen Plan eines Paares geübt – mit dem Risiko, sowohl den Prozess mit ihnen als auch mein Honorar zu verlieren (das war nämlich noch nicht bezahlt). Es ging um einen weiteren Kinderwunsch, den eine Person hatte, die andere deutlich nicht. Ein Mädchen soll die Leiden und Verletzungen (die beim jüngsten Sohn entstanden waren) „ausbügeln“, weil das so ein schweres Los war.
„Bei allem Respekt – bei dieser Entscheidung geht es verdammt noch mal nicht um euch zwei. Sondern um ein ungeborenes Kind. Niemand sollte mit einer derartigen Verantwortung auf die Welt kommen müssen. Schon gar nicht, wenn dann auch noch eure Beziehung auf dem Spiel steht.“ Das waren meine Worte.
Kinder sind kein beliebiges Spielzeug, kein Beziehungskitt und kein Trostpflaster. Das musste an dieser Stelle gesagt werden – für meinen Seelenfrieden.
NOVEMBER „Familie wirkt. Ob wir das nun gut finden oder nicht.“
In meinen ersten zwölf Wingwave-Sessions kam erstaunlich klar zum Vorschein, was ohnehin landläufig bekannt ist. Die Prägungen und Erfahrungen in unseren Herkunftsfamilien picken so fest, dass uns oft weniger lieb wäre. Emotionale Verstrickungen, fehlgeleitete Dynamik und manipulatives Verhalten erschweren oft bis ins hohe Erwachsenenalter die Beziehung zu unseren Eltern und Geschwistern. Wie gut, dass es verschiedene Wege und Methoden gibt, darauf zu antworten, denn NEIN: Du bist deiner Geschichte nicht hilflos ausgeliefert. Und JA: Es wirkt auf dich, egal ob dir das bewusst ist oder nicht.
DEZEMBER „Hilflosigkeit ist was Hässliches, und die Klappe halten ist schwierig.“
Gerade wenn es im engeren Umfeld Beziehungsbrösel gibt, ist das schwer auszuhalten. Besonders mit meiner Profession. Anerkennen, dass man hier nicht helfen kann, lässt sich kaum ertragen. Zuschauen, wie Dinge zunehmend schwierig werden, noch mehr. Ich lerne gerade, mich auf meine Rolle in meinen Systemen zu konzentrieren und nicht mehr zu wollen als andere Beteiligte. So viel kann ich schon sagen: Ich reiße lieber alles nieder und verausgabe mich bis zum Umfallen, als in krisenhaften Situationen auf der Zuschauerbank zu sitzen. Das erklärt wohl, warum ich diesen Beruf ausübe.
Im Vergleich zu anderen Jahren war 2025 verdächtig ruhig. Bei genauerer Betrachtung hatten es diese 365 Tage ganz schön in sich. Ich bin wieder ein Jahr älter und merke zunehmend: Ich hab keinen Bock und keine Nerven mehr für halbe Sachen. Oberflächlichkeiten und belanglose Verbindungen kommen auf den Prüfstand. Ich will dem Leben in die Augen sehen. Meine Zeit auf die Menschen und Tätigkeiten verwenden, die wertvoll, sinnstiftend und inspirierend sind. Und meine Energie dahin stecken, wo ich sie gut investiert sehe: in meine wichtigsten Beziehungen, meine Arbeit und meine körperliche, emotionale und geistige Gesundheit.
2026. I am ready for you.
Bring it on.
Was hast du 2025 gelernt? Schreib mir gern, welche Beziehungserkenntnis dich weiter gebracht hat! Ich freu mich über dein Kommentar.

von Kerstin Bamminger | Nov. 17, 2025 | Allgemein, Hilfreich, Leben, Paarbeziehung
Am Rand des nervlichen Abgrunds
„Die Frauen müssen halt aufhören, alles immer so perfekt machen zu wollen!“ War der Originalsatz der kinderlosen Psychologin, die neben mir Platz genommen hatte. Obwohl wir beide als Expertinnen geladen waren, blieb mir kurz die Spucke weg. Denn es war nicht nur fehlendes Wissen, sondern blanker Hohn, was sie von sich gab.
Während ich im Kopf den proppenvollen Alltag von Kleinkindfamilien vorüberziehen sah mit den unendlich vielen To-Dos und Dingen, die bedacht werden müssen schüttelte ich innerlich den Kopf. Gestandene, gut organisierte Frauen wandeln ob dieser Anforderungen am Rand des nervlichen Abgrunds. Ich fühlte, wie das Gespräch in eine problematische Richtung abbog und erlaubte mir nicht, direkt zu widersprechen. Doch ich blieb einigermaßen sprachlos zurück.
Man muss keine Kinder haben, um das Problem zu verstehen. Es reicht ein Mindestmaß an feministischem Denken, Fühlen und Verstehen.
Wie sich Mental Load anfühlt
Das Piepsen der Müllabfuhr Freitag Morgen reißt mich vom Küchensessel, ich eile mit dem Biomüll gerade noch rechtzeitig zur Tonne hinaus. Beim Hineingehen sehe ich den verwelkten Blumenstock an der Tür, der getauscht werden müsste. Stolpere in der Garderobe über zu viele Schuhe – die gehören längst wieder mal aussortiert, weil sie den Kids nicht mehr passen. Ich wasche den Biokübel aus, will einen neuen Beutel reingeben, doch ich greife in den leeren Karton. Also schnell auf die Einkaufsliste setzen, da koppt eine Erinnerung am Handy auf: die Zahnarzttermine sind wieder fällig. Während ich die Brote streiche, piepst schon die Waschmaschine, beim Geschirrspüler ist das Salz nachzufüllen und ein Kind ruft aus dem oberen Stock „Ich brauch’ noch 36€ für den Schulausflug – aber genau, bitte!“
Neverending story
Das ist Mental Load – und nein, es ist kein Luxusproblem, kein Frauenhobby und keine Überempfindlichkeit. Es ist die mentale Belastung des daran denken müssen, oder anders gesagt: die unsichtbare Denkarbeit, die dafür sorgt, dass das Leben rund läuft. Zwischen Terminen, To-Dos und notwendigem Vorchecking.
Fast immer hängt dieser in Familien überwiegender Weise bei den Müttern – warum das so ist, klären wir hier noch. Wir sind die, die erinnern, koordinieren und (für alle) mitdenken. Es geht nicht um das Tun, sondern um das Denken an das, was zu tun ist. Das Verheerende: diese Arbeit im Kopf hört nie auf.
Gedankenleere Räume
„Woran denkst du grad?“ Frag ich öfter meinen Mann. Und obwohl wir eine sehr feine Gesprächsbasis haben, eine offene Kommunikationskultur und ausladende Unterhaltungen lieben, sagt er manchmal: „Nix.“ Das ist für mich so ein unvorstellbarer Zustand, den ich mir nur hart auf der Yogamatte oder hin und wieder in Meditation erarbeiten kann, dass ich fast ein wenig neidisch auf ihn bin. Ich hab mich auch bei anderen eloquenten, kommunikativen und reflektierten Männern erkundigt: diesen Zustand gibt es anscheinend tatsächlich.
An dieser Verwunderung kann ich schon erkennen, dass ich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit stärker den Mental Load unserer Familie trage: in meinem Kopf ist es ganz selten still.
Was genau falsch läuft, wo die häufigsten Missverständnisse liegen und was unbedingt anders gedacht werden muss, kläre ich hier und heute mit sechs Bullshit Sätzen samt Erklärung auf.
Die BULLSHIT Sätze:
“Wenn’s dich stresst, dann hör halt auf, alles perfekt machen zu wollen.“
Ja, es gibt sie. Die Eltern, die jede Jausendose in ein kulinarisches und optisches Wunderwerk verwandeln, Brot in Sterne ausgestochen servieren und Geburtstagsmuffins für den Kindergarten so aufwendig verzieren, dass der örtliche Konditor vor Neid erblasst.
Manchen machen diese Dinge Spaß und die sollen es um Himmels Willen weiter so tun dürfen, wenn sie wollen.
Doch für alle anderen von uns gilt: Mental Load entsteht nicht aus unserem Perfektionismus, sondern aus Verantwortung. Weil irgendwer nun mal die Jause zubereiten und den Kuchen für die Geburtstagsfeier bereitstellen muss. Es geht nicht darum, alles richtig zu machen, sondern darum nichts zu vergessen, was sonst keiner macht – und worauf andere mündige Erwachsene sich verlassen.
„Du musst halt mal loslassen – dein Partner kann das auch!“
Ja, es gibt Menschen, die trauen ihren Partner*innen nicht mal zu, die eigenen Kinder ins Bett zu bringen. Lieber übernehmen sie alles selbst und behalten die Kontrolle, bevor alles nicht exakt so läuft, wie sie sich das vorstellen.
Doch Loslassen funktioniert nur, wenn da jemand anderes DA ist, der auch wirklich übernimmt. Vor allem, wenn niemand mehr daran denkt und erinnert. Verantwortung kann man nicht einfach fallen lassen, wie eine heiße Kartoffel – dafür geht es um zu viel: die eigenen Kinder, das eigene Wohlbefinden und die Sicherheit. Frauen machen leider die Erfahrung, dass das nicht gelingt und wichtige Dinge nicht oder fehlerhaft passieren, wenn sie nicht dahinter sind. Beispiele aus der Praxis?
- Es wird vergessen, Medikamente zu verabreichen.
- Einschlafbegleitungen eskalieren, weil Feinfühligkeit fehlt.
- Kinder werden nicht warm genug angezogen und erkälten sich.
Ich sag zwar immer: „Die Väter sind zumutbar.“ Manches halte ich jedoch auch beim Mitzuhören nur sehr schlecht aus und verstehe die Mütter umso besser.
„Ich helfe dir doch eh im Haushalt und mache fast alles!“
Tut mir Leid, das zu sagen, aber Hilfe ist da nicht gefragt. Wer „hilft“, sieht sich selbst nicht mitverantwortlich, sondern verleiht das Gefühl, es wäre eigentlich mein Job. Gutwilliger Weise nimmt man mir davon was ab.
Nein. Gleichwertige Aufteilung beginnt da, wo BEIDE den Überblick und die Verantwortung tragen, wo Bereiche sinnvoll und klug aufgeteilt werden und jeder das übernimmt in voller Konsequenz, was sein oder ihr Aufgabengebiet ist. Nicht, wo einer „mitmacht“ und dafür gerade nicht auch noch beklatscht werden will.
Wer in einem Haushalt zusammenlebt, trägt für die eigene Wäsche, den eigenen Lebensmittelbedarf oder den Dreck, den man verursacht prinzipiell selbst die Verantwortung. Partnerschaftliche Aufteilung bedeutet: jeder macht, was er kann und was notwendig ist, um das Leben BEIDER zu erleichtern.
„Ich sag dir ja immer, du brauchst mir nur sagen, was zu tun ist!“
Genau das ist jedoch Mental Load. Selbst der willigste Partner, der alle Dinge auf der Liste wie vereinbart erledigt, hat noch nicht entlastet, wenn es um die Denkarbeit geht. Die Frau ist immer noch diejenige, die Energie, Aufmerksamkeit und Fokus verliert wie ein Computer, bei dem dutzende Tabs offen sind, weil sie für Kinder (und Partner) mitdenkt. Das kostet Arbeitsspeicher und Energie und daher fühlen sich die Frauen am Ende des Tages wie ein abgestürzter PC.
Erinnern, Denken, Koordinieren – und vor allem: die Fülle dieser vielen kleinen Aufgaben sind das Problem. Wenn du jemanden brauchst, der dich erinnert, Günther, dann ist das keine Entlastung. Das ist Outsourcen deiner Verantwortung an die Person, die ohnehin zu viel für andere (Minderjährige) mitdenken muss.
„Dir kann man es ja sowieso nicht recht machen – mit deinen Ansprüchen. Wozu bemühen?“
Dass Frauen „unrealistisch hohe Ansprüche“ haben, die ihre Männer „sowieso nie erfüllen“ können ist ein dazugehöriges Problem. Die Latte hängen Frauen sich nicht selbst so hoch, sondern die Gesellschaft, die Frauen ständig daran bewertet, wie sie das mit Kind und Kegel so schaffen.
In Befragungen haben 30% der Männer außerdem angegeben, dass sie sich manchmal absichtlich ein wenig dumm anstellen, damit sie die Aufgabe nicht nochmal aufgetragen bekommen. 30% (!!!) sagen das öffentlich, wenn jemand wildfremder fragt. Die Dunkelziffer will ich lieber nicht kennen.
„Even a top-tier-man is just an average woman“
hab ich neulich auf Instagram gelesen. Was bei Frauen selbstverständlich ist, wird bei Männern glorifiziert. Was bei Frauen erwartet wird, wird bei Männern gefeiert. (Bedeutet so viel wie: „Selbst ein Mann auf Top-Niveau ist gerade mal eine durchschnittliche Frau.“)
- Er plant die Geburtstagsfeier? Der ist ja ein Jackpot.
- Wow, er geht sogar mit dem Kind zur Spielgruppe? Du hast ja Glück.
- Dein Mann besorgt den Adventkalender? Wow, so einen hätte ich auch gern.
Es gibt ja auch noch viel schlimmere Männer, ich weiß. Doch die Messlatte hängt so tief, dass sogar die Hölle angerufen hat, dass sie die nicht haben will, lautet Tara Wittwer’s Antwort darauf.
„Frauen sind halt besser organisiert! Es liegt in ihrer Natur!“
Nein, es liegt in der Sozialisation und fixierten, altbackenen Rollenbildern. Frauen müssen oft besser organisiert sein, weil es von Anfang an von ihnen erwartet wird. Sie werden gelobt, wenn sie sich besonders gut um andere kümmern, fürsorglich sind und emphatisch agieren. Jungs bekommen Schulterklopfer, wenn sie ein wenig spitzbübisch, waghalsig und sich durchsetzen. Es ist kein Talent, sondern ein System, das Menschen unterschiedlichen Geschlechts unterschiedlich formt.
Das Gehirn ist bei der Geburt identisch. Erst die Erfahrungen, die Kinder im Heranwachsen machen, wofür sie bestärkt werden und was ihnen zugetraut wird, macht sie zu geschlechtstypischeren Wesen. Und zementiert z.B. die ungleiche und ungerechte Verteilung von unbezahlter Arbeit ein, statt sie fairer zu verteilen. Weil beide es könn(t)en.
Wie wir es besser machen können
„Ach, wie ihr Frauen immer jammert. Geht doch endlich dran, eure Probleme zu lösen!“ So tönt es aus Kommentarspalten unter Mental Load Beiträgen auf Social Media.
Sachliche Kritik wird als Jammern abgetan, die strukturelle Ungelichverteilung als „Kommunikationsproblem“. Nichts desto Trotz will ich den Abschluss hier lösungsorientiert, motivierend und praxisnah gestalten.
Nicht, weil wir das Problem lösen müssen. Sondern weil ich mich immer besser fühle, wenn ich die Idee hab, wie ich selbst was anders machen kann. Daher hier Tipps für Paare, die die mentale Arbeit des Daran denken müssen fairer verteilen möchten.
Zum Abschluss ein konstruktiver Teil – lösungsorientiert, motivierend, praxisnah:
- Sichtbar machen: Sprecht über die Aufgaben, die unsichtbar sind. Macht Listen und schreibt alles auf, woran zu denken ist, damit der Laden läuft. Das ist die Basis für …
- Verantwortung teilen: Nicht Hilfe anbieten, sondern Zuständigkeit übernehmen. Ganze Prozesse auslagern, nicht nur Arbeitsschritte eines Projekts delegieren.
- Mental Load regelmäßig checken: Wer trägt gerade wie viel? Wie fühlt sich das an? Diese Gespräche als Anlass nehmen, über eigene Werte und Bedürfnisse ins Gespräch zu kommen.
- Definition of done: bei einzelnen Arbeitsabläufen (egal ob Wäsche falten, Brotdosen richten oder der Geburtstagstorte): was ist eure „Definition von Erledigt“. Wo hat jeder seinen Raum sich individuell zu entfalten in der Abwicklung und was ist absolutes Minimum.
- Vertrauen üben: Wenn der andere übernimmt, nicht kontrollieren – sondern loslassen lernen. Ermutigen und dann auch eventuelle Konsequenzen selbst übernehmen lassen.
- Systeme ändern, nicht Menschen: Wir brauchen Strukturen, die Entlastung ermöglichen – nicht mehr Selbstoptimierung. Manches schaffen wir nicht in der Familie. Es braucht die Gesellschaft und die Politik. Daher zahlt sich laut bleiben und aufzeigen immer aus. Steter Tropfen höhlt den Stein. Da bin ich mir ganz sicher.
Einladung zum Gespräch
Mental Load wird kleiner, wenn wir anfangen, darüber zu reden. Nicht mit Vorwürfen, sondern mit echtem Interesse. Denn wer Verantwortung teilt, teilt auch Erleichterung. Wo das Verständnis für diese Arbeitsleistung einziehen kann, ist der Weg zur fairen Aufteilung geöffnet. Und Gespräche über die tiefer liegenden Wertvorstellungen, Bedürfnisse und Ausrichtung erhellen den Pfad.
Ein Einstieg? Gemeinsam den Qual Care Test machen und darüber ins Gespräch kommen, wer was übernimmt und überhaupt vorher schon daran denkt. Lösungen ausprobieren und testen – evaluieren und anpassen wie ein Projekt in einem Betrieb. So soll und darf das sein. Projektmanagement vom Feinsten. Damit können Männer bestimmt gut was anfangen.
Warum sich das auszahlt? Weil Gleichberechtigung und gleichwürdige Aufteilung von Arbeitslast in Familien das beste Investment in Langlebigkeit von Beziehung ist und die Wertschätzung für das Tun des jeweils anderen (in jedem Bereich) auf ein völlig neues Niveau hebt.
Wenn du spürst, dass in eurem Alltag mehr Denkarbeit an dir hängenbleibt, bist du damit nicht allein –
und du bist auch nicht zu empfindlich.
Gleichberechtigung beginnt damit, dass wir sichtbar machen, was lange unsichtbar war.
Hol dir den Equal Care & Mental Load Test, tauch ein Stück tiefer in eure Aufteilung ein und
nimm ihn als Einladung zu einem guten Gespräch.
Nicht um Schuld zu verteilen – sondern um Entlastung, Wertschätzung und echte Partnerschaft zu schaffen.
Dein Alltag darf leichter werden.
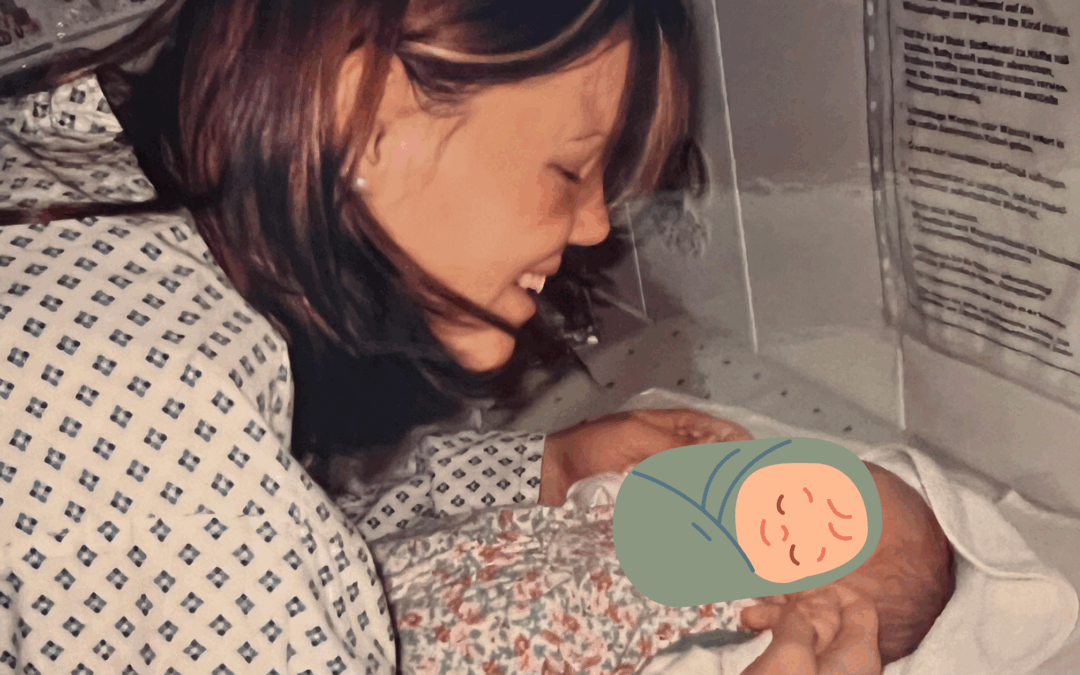
von Kerstin Bamminger | Okt. 29, 2025 | Allgemein, Elternbeziehung, Leben, Paarbeziehung
Nach 21 Jahren Mama-Sein ziehe ich Bilanz: Was ich heute als Mutter anders machen würde, welche Fehler ich nicht mehr wiederholen würde – und worauf ich trotzdem stolz bin.
🎂 Geburtstage – mehr als Torte und Kerzen
Sie sind eine Einladung – nicht nur zum Feiern, sondern auch zum Zurückblicken und Reflektieren.
Als unsere Erstgeborene ihren 21. Geburtstag feierte, spürte ich diesen Impuls wieder mal besonders intensiv:
Ich wollte verstehen, was wir als Eltern gut gemacht haben – und wo wir heute vielleicht anders handeln würden.
Meine 5 größten Fehler als Mama füllen einen anderen Beitrag.
Elternschaft – eine Reise ohne Landkarte
Elternschaft ist eine wilde Reise – von der man (bevor sie beginnt) in Wahrheit reichlich wenig Ahnung hat. Ich hab Erzählungen anderer Eltern nicht geglaubt („Ich stell mich ja sicher mal nicht so blöd an!“) und dachte mit vier jüngeren Schwestern und als gelernte Kleinkindpädagogin hab ich alle Weisheit auf meiner Seite. Was soll schon passieren?
Wenn du schon Elternteil bist, wirst du schon an dieser Stelle milde lächeln und dich womöglich selbst wieder erkennen. Ich will ehrlich sein:
NEIN, wir haben nicht alles falsch gemacht.
JA, ich hatte Vorteile, weil ich Babypflege und-betreuung schon aus nächster Nähe miterlebt hatte.
JA, die pädagogische Ausbildung war gold wert.
JA, ich bin sehr stolz auf das Allermeiste, was wir als Eltern geleistet haben.
NEIN, wir waren auf die Realität trotzdem nicht vorbereitet.
Als ich mein 22. Jahr Elternschaft begann, habe ich mich gefragt:
„Was würde ich anders machen, wenn ich noch einmal von vorne anfangen könnte?“
Elternschaft konfrontiert dich mit dir selbst, deinen Grenzen, deinen Schatten – und deinem Herzen.
Wenn du schon Mama oder Papa bist, nickst du wahrscheinlich gerade.
Denn du weißt, wie es ist, voller Überzeugung loszugehen – und dann ganz neu lernen zu müssen.
Und auch wenn ich heute weiß, dass wir vieles richtig gemacht haben:
Wir waren nicht vorbereitet auf die Realität.
Die Antworten auf meine Frage sind ehrlich. Manchmal unbequem. Aber befreiend.
WÜRDE ICH ELTERN SEIN VON VORN BEGINNEN KÖNNEN, WÜRDE ICH …
1️⃣ Ich würde die unangenehmen Gespräche zuerst führen.
Eine Familie zu werden ist so unendlich idyllisch aufgeladen. Die allermeisten Menschen vergessen über dem Zauber des heranwachsenden Lebens, zentrale Dinge vorab zu klären. Und JA: da müssen Dinge besprochen werden. Ich würde also darauf bestehen, grundsästzliche Fragen zum Eltern sein mit meinem Partner durchzugehen, wie:
- Wie wollen wir die Arbeitslast eines Kindes (Care Arbeit) fair auf uns zwei verteilen?
Denn nein, Care Arbeit ist niemals nach 40 Wochenstunden erledigt und beide sind zuständig und fähig diese Arbeit zu tun.
- Wie wollen wir unsere Rollen als Vater / als Mutter generell anlegen und leben?
Wenn wir das nicht bewusst gestalten, finden wir uns schneller als uns lieb ist in den vorgelebten und womöglich sehr veralteten, traditionellen Rollenmustern wieder, die wir vielleicht so gar nie haben wollten.
- Wie sorgen wir für finanzielle Fairness, wenn einer mehr unbezahlte Arbeit (auch Haushalt) erledigt als der andere?
Wenn im Bereich Finanzen eine Schieflage entsteht, die nicht mit absoluter Wertschätzung und Offenheit behandelt wird, prägt das andere Lebensbereiche verlässlich negativ mit.
- Werden wir ein Pensionssplitting vereinbaren?
Oder anders gefragt: sind wir bereit unsere Einzahlungen fair zu verteilen, wenn wir unterschiedlich viel unbezahlte Arbeit leisten – haben wir die nötige Wertschätzung für BEIDE notwendigen Lebensbereiche?
- Wie wollen wir dem potenziellen Schlafmangel entgegen treten?
Sollten die Nächte sehr fordernd sein, müsst ihr euch als Team verstehen. Sonst verliert einer nicht nur den Schlaf, sondern auch bald den Verstand und jede Kooperationsfähigkeit.
- Wo werden wir lernen, was es braucht, um gute Eltern zu sein?
Denn, NEIN. Eltern sein ist nicht angeboren oder instinktiv zu erledigen. Es braucht unglaublich viel Know-How, Fachwissen und Bildung, um dem herausforderndsten, komplexesten und bedeutendsten Job der Welt halbwegs passabel erledigen zu können. Ja, du brauchst auch dein Gefühl – aber weitaus mehr erzieherische Kompetenz als du meinst.
- Welche Werte möchten wir in unserer Begleitung der Kinder hoch halten?
Wenn klar ist und regelmäßig geklärt wird, welche Werte oberste Priorität haben, fällt das Entscheidungen treffen leichter. Und du wirst sehr viele Entscheidungen treffen. Jeden Tag. Werte sind dein Kompass und dein Anker – du solltest sie im Schlaf aufsagen können.
- Wie verteilen wir den Mental Load, der sich durch Elternschaft potenziert, fair?
Wenn die ganze Denkarbeit an einer Person hängen bleibt, kann das Gefüge sehr schnell kippen und in die Überforderung führen. Es zahlt sich aus, erst gar nicht in diese Falle zu tappen versuchen – sollte das möglich sein.
- Wie sorgen wir für absolute finanzielle Transparenz und Gleichwürdigkeit? Besonders in Zeiten, wo wir nicht beide vollerwerbstätig sind, weil Kinder Zeit und Betreuung von uns brauchen?
Finanzielle Offenheit und gleichwürdiger Umgang sollten bare minimum sein, ist es aber oft nicht. Wer darauf nicht achtet findet sich schneller in Machtspielchen beim Tarnen und Täuschen wieder, als einem lieb ist. Das könnte ein großes Aua geben.
Hinter jeder einzelnen Frage steckt so viel. Nein, wir haben keine einzige dieser Fragen vor unserem ersten Kind geklärt – sondern als die Themen laut an unsere Tür geklopft haben. Wir haben erst viel zu spät bemerkt, wie stark wir ins Thema Eltern sein rein gerutscht sind, ohne bewusst zu machen, was da mit uns passiert. Das tut im Nachhinein ein bisschen weh.
Wir haben überlebt. Weil wir uns den unangenehmen Gesprächen gestellt haben.
Kann sein, dass eine von uns nicht aufgegeben hat, diese Fragen auf den Tisch zu bringen. Ups.
Glücklicherweise hatten wir ähnliche Vorstellungen von dem, wie Familie für uns aussehen sollte. Wir lebten lang ein traditionelles Rollenmodell, für das wir uns beide mehr oder weniger bewusst entschieden hatten. Trotz aller finanziellen Nachteile würde ich immer wieder den Weg gehen, die Kinder in den ersten (mindestens drei) Jahren selbst zu betreuen – für mich eine der besten Entscheidungen, wenn ich zurück schaue. Alles was es an Ausgleich dazu gebraucht hat, haben wir dann in harten Verhandlungen später fest gelegt. Den Teil hätte ich uns gern erspart – auch wenn er notwendig war.
Was ich noch anders machen würde?
2️⃣ Ich würde ein riesiges Familienbett anschaffen.
Nach kurzen Bemühungen bei Kind 1 es nach einigen Monaten im Babybett anzugewöhnen (wir scheiterten natürlich kläglich), schliefen wir überwiegender Weise in unserem Doppelbett. Zu dritt, zu viert, ganz selten zu fünft (da waren die Älteren dann schon raus).
Da wir in zahllosen Nächten zu wenig Platz hatten, würd ich aus heutiger Sicht in ein gigantisches Familienbett investieren (mindestens 3,5 m breit), wo alle nebeneinander einen gemütlichen Schlafplatz haben. In meiner Vorstellung wären die Nächte dann entspannter gewesen als mit der Notlösung, die wir aufbrachten: wir haben einfach ein Einzelbett mit Kabelbindern für ein, zwei Jahre an unser Ehebett dran gebunden.
3️⃣ Ich würde Besuche verschieben und das Wochenbett heilig halten.
Die Vorstellung, so früh wie möglich wieder „wie vorher“ zu funktionieren, weil das ein Zeichen dafür wär, es als Mutter besonders gut zu machen ist kompletter Bullshit. Keine Ahnung, wer sie mir in den Kopf gesetzt hat, aber sie war da. Erst bei Kind Nummer drei hatte ich die Coolness, Ruhe und Abgeklärtheit, allen zu sagen, dass es mir nicht gut ging (was eine reine Lüge war, mir ging’s blendend).
Diese Aussage hält verlässlich alle ungebetenen Besucher*innen fern und garantiere mir ein super entspanntes Wochenbett. Und die liebsten Freundinnen, Schwestern und engste Familie … über die freut man sich im besten Fall sowieso. wenn sie verstanden haben, wie ein guter Wochenbettbesuch aussieht! Rückblickend wünschte ich, das schon beim ersten Kind verstanden zu haben. Es „brauchte“ leider zwei, drei Brustentzündungen und eine ausgewachsene Erkältung, bis ich checkte, dass ich niemandem was beweisen muss. Schon gar nicht mir selbst. Und dass die ersten Wochen eine heilige Zeit sein dürfen, die so störungsfrei und ruhig wie möglich ablaufen dürfen.
Rückblickend: So viel richtig gemacht
Beim Zusammentragen dieser Erkenntnisse wurde mir vor allem aber eins klar: ich hab SO SO SO viel richtig gemacht, gut entschieden und mega bewältigt. Ich war 24 Jahre jung und hatte ein fantastisches Gespür für meine Babies, war so präsent und hab feinfühlig beantwortet. Die ersten Jahre sind fürchterlich anstrengend, doch es ist das beste Return on investment, das ich mir vorstellen kann. Wir haben so viel gelacht und miteinander erlebt. Wann immer ich ein altes Familienvideo aus der Schublade krame (Ja, das waren noch DVDs!), hören meine Kinder diesen Satz am häufigsten: „Ma, ham’s wir schön g’habt.“
Mir stehen jetzt wieder die Tränen in den Augen, während ich das schreibe.
Denn: JA – manches würd ich heut anders machen. Aber auf noch viel mehr in diesen 21 Jahren Elternschaft bin ich unglaublich stolz.
Du wirst bald Mama oder Papa und möchtest dich gut vorbereiten?
Dann schnapp dir meinen Kurs „PLÖTZLICH ELTERN – mit Teamgeist das erste Jahr meistern“ und hole dir, was ich zusammengetragen hab an Know-How, praktischen Tipps und klugen Ansätzen, wie es gelingen kann. Denn LEBENDIGE BEZIEHUNGEN beginnen mit dem ersten Atemzug.
👶 Für alle, die gerade Eltern werden
Wenn du bald Mama oder Papa wirst und dich bewusst auf Elternschaft vorbereiten willst,
dann schnapp dir meinen Kurs:
Darin steckt all mein Wissen aus 21 Jahren:
Fachliches Know-how, praktische Tipps, ehrliche Erfahrungen und Strategien,
damit euer Start als Familie gelingt.
Denn: Lebendige Beziehungen beginnen mit dem ersten Atemzug.

von Kerstin Bamminger | Okt. 17, 2025 | Allgemein, Frauenstärke, Leben
Ich bin in eine alte Falle getappt – wieder einmal. Ein Kommentar, ein kleiner Shitstorm und eine Erkenntnis: Als Frau kannst du es einfach nicht (allen) recht machen. Welchen Fehler ich genau begangen hab, warum Kritik oft mit zweierlei Maß gemessen wird – und was das mit uns allen zu tun hat, liest du hier:
Was ein einziger Kommentar in mir ausgelöst hat.
Am dritten Oktober 2025 veröffentlichte Taylor Swift ihr neues Album. Vermutlich hast du nicht nur in meinem letzten Newsletter, sonder auch über andere Medien darüber erfahren. Es gab Zeitungsberichte, Fernsehauftritte und Radiostationen, die berichteten. Vor allem die sozialen Medien waren voll mit Beiträgen, kurzen Clips und Analysen zu dem Album. Sie wurde gefeiert, von Fans in den Himmel hoch gejubelt und stellt mit dem Album einen Rekord nach dem anderen ein. Das gefällt vielen, aber nicht allen.
Wo viel Licht, da viel Schatten.
Den prominenten Namen nützen viele Menschen, um ein bisschen von dem Ruhm mitzunaschen. Nicht zuletzt, weil es eine starke Fanbase gibt, die jedes Stückchen Information von ihr genießt, sich ihre Interpretationen auf der Zunge zergehen lässt und sie in fast religiöser Weise verehrt. So viel Licht macht erstens meist nicht nur Freunde, sondern wirft auch Schatten.
Also taucht im Zusammenhang mit ihr auch herbe Kritik auf. Vieles davon durchaus berechtigt. Sie sei eine Kapitalistin, die unethisch ihr Vermögen verdient hat und eine Wirtschaftsmaschine, die (junge) Fans gezielt und bewusst manipuliert, um viel Geld für ihre Platten oder ihren Merch (Fanartikel) auszugeben.
Kritik ist immer angebracht, wenn sie konstruktiv bleibt und mit gleichem Maß misst, wie ich finde. Ich gehe total mit dem Vorwurf konform, dass Milliardäre kaum ethisch genug sein können und es Reichensteuern braucht und auch den Einsatz von manipulativem Marketing sehe ich bedenklich. Was ein gemeinnütziges Online Magazin allerdings in einem Reel behauptet hat, entbehrt teilweise jeder Grundlage. Und hat mich zu einem Kommentar und einer kleinen Frage hingerissen. Womit wir bei meinem Fehler wären.
Was nicht im Kopf verhallt.
Leider hab ich die komische Eigenschaft, Dinge verstehen zu wollen, damit ich sie einordnen und verarbeiten kann. Deshalb hab ich in der Kommentarspalte unter dem Video nachgefragt, woher die Feststellung komme, dass Swift’s Texte „misogyn und rassistisch“ sind. Natürlich fühlte ich mich ein Stück weit persönlich angegriffen. Ich höre seit Jahren sehr viel von ihrer Musik und achte genau auf die Texte. Gleichzeitig bin ich eine glühende Feministin und Menschenfreundin – die Anschuldigung, dass Kunst, die mir gefällt, rassistisch und frauenfeindlich ist, verhallt nicht einfach in meinem Kopf.
„Rage bait“ vor korrekten Behauptungen
Was danach in den Kommentaren abging, war wirklich bemerkenswert. Das vielzitierte sonst gründlich recherchierende Magazin ging mit keiner Silbe auf irgendeinen Kommentar oder andere offene Fragen ein. Klare Strategie dahinter: Rage bait. Das heißt, mit dem Zorn der Menschen auf viel Aufmerksamkeit, Medienpräsenz und Klicks hoffen – was wunderbar geklappt hat. Das könnte man auch mal ganz grundsätzlich hinterfragen. Wie ging es weiter?
Vom Mond auf die Erde geholt
Einige andere Instagram User:innen fühlten bemüßigt, meine Fragenzeichen aus dem Kopf zu entfernen. „Wish List“ sei misogyn und rassistisch, weil Taylor darüber singt, sich einen Haufen Kinder mit Travis zu wünschen, die alle wie sie aussehen. Dass sie mit „MAGA-Fans“ abhänge, so die weitere Kritik und mit „Cancelled“ Menschen am rechten politischen Rand gut finden würde, die beleidigende, diskriminierende und homophobe Aussagen oder Handlungsweisen befürworten. Auch wenn ich es letztlich nicht eindeutig widerlegen kann: keine Person aus diesem Spektrum würde im selben Song singen: „Did you make a joke only a man could?“
Diese Anschuldigung (Frauenhass & Fremdenfeindlichkeit) ist weiter hergeholt als der Mond von der Erde entfernt ist.
Haters gonna hate.
Doch es geht gar nicht darum, ob ich nun recht habe und sie doch keine Rassistin oder Frauenhasserin (I mean…??!) ist. Was mir zwischen all den 374 Antworten vor allem bewusst wurde: als Frau KANNST du es einfach nicht recht machen. Oder, wie Taylor es sagen würde … „haters gonna hate“. Das gilt besonders für Frauen. Und macht mich ganz schön nachdenklich.
Hohe Ansprüche und verschiedene Messlatten
Nein, wir sollten nicht kritiklos alle Prominenten abfeiern. Es gibt oft genug Gründe zu zweifeln.
Nein, wir sollten nicht genau dieselben Maßstäbe an öffentliche Personen mit enormer Reichweite anlegen – sie haben mehr Verantwortung als ein Durchschnittsbürger.
Doch mit welchem Hass, mit welcher Schärfe und enormer Härte wir besonders Frauen bewerten, lässt mir einigermaßen die Kinnlade runter kippen. Selbst wenn du richtig viel richtig machst: sie werden kommen, um über dich zu richten und jede noch so kleine Ungereimtheit zu deinen Ungunsten interpretieren, um dir zu schaden.
Der wahre Verlust ist dabei viel größer. Er betrifft nämlich alle Frauen. Wenn wir es einfach nicht schaffen, Frauen ihren Erfolg zu gönnen und ihre harte Arbeit zu honorieren und uns stattdessen weiterhin gegenseitig zu zerfleischen, hinterlässt das bei mir einen sehr schalen Beigeschmack. Vor allem, wenn wir zeitgleich Männer mit denselben „Fehlbarkeiten“ (oder schlimmeren, siehe z.B. Sean Combs) ungeschoren davon kommen lassen.
Ist okay, dass Swift erfolgreich ist, aber sie soll bitte in den Augen der Kritiker auch noch die erste ethische Milliardärin sein, die bankrotte amerikanische Politik herumreißen und alle Frauen dieser Welt retten, weil ihre Mittel dafür reichen. Das schreiben echte Menschen in diesen Kommentaren. Hier wird klar:
Du kannst es einfach nicht recht machen.
Was im Großen nämlich für die Beyonces, Rhiannas und Taylor Swifts dieser Welt gilt, gilt schon lange im Kleinen für jede einzelne Frau in ihrer Lebensrealität.
Du darfst nicht zu dünn und nicht zu dick sein, nicht zu leise und nicht zu laut, nicht zu jung und nicht zu alt sein, um Kinder zu bekommen. Du sollst nicht zu wenige und nicht zu viele Kinder haben, nicht Karrierefrau aber auch nicht Hausmütterchen sein, vor allem nicht zu emotional aber bitte auch nicht kaltblütig. Ich bin sicher, jede Frau, die das liest, kann in irgendeiner Weise andocken, weil jede von uns das früher oder später am eigenen Leib erfährt.
Verbindendes vor Trennendes stellen – eine kluge Idee
„Ob es mir nicht reiche, dass sie mit MAGA Leuten abhänge?“ wurde ich bei meiner verzweifelten Suche nach Antworten in der Kommentarspalte gefragt. Natürlich finde ich die politische Haltung vieler Trump Anhänger schwierig. So schwierig, dass ich teilweise die Lust am Debattieren verlier – und das mag was heißen bei mir, denn ich lieeeebe herzhafte Diskussionen. Wir haben ja einiges an Familie in den USA und Teile davon sind auch Republikaner und Trump-Wählerinnen. Kann ich das verstehen? Definitiv nicht. Aber mag ich diese Menschen trotzdem? Aus vollem Herzen. Wir wissen halt, dass es meistens klüger ist, politische Themen auszusparen – damit wir unsere Beziehung zueinander aufrecht erhalten können. Wir können das Verbindende vor das Trennende stellen.
Das wünsche ich mir auch im Großen und Ganzen. Für alle Menschen, besonders aber für uns Frauen.
- Ein bisschen weniger Neid auf die Erfolge der anderen und ein wenig mehr Mitfreuen und Euphorie wenn Dinge geschafft sind.
- Ein bisschen weniger Hass auf die glitzernden Persönlichkeiten und ein wenig mehr Liebe mit dem Bewusstsein: wir sind alle Menschen, die irgendwie versuchen, dieses kleine Leben zu genießen.
- Ein bisschen weniger Perfektionismus und ein bisschen mehr Menschlichkeit und Milde, damit wir begreifen: niemand muss alles perfekt machen. Es reicht, gut genug zu sein.
Late to the party
Das besagte Magazin hat angesichts der Kommentarexplosion dann doch noch ein Statement verfasst, sich aber weiter gerechtfertigt und dann einen Teil sang- und klanglos wieder gelöscht, weil die Quellenangabe nicht gehalten hat. So gehe ich mit ein klein wenig Genugtuung aber der Erkenntnis, die Kommentarspalten zu heißen Themen großräumig zu umschiffen, in dieses Wochenende. Und beende diesen Text mit einem Zitat:
Allen Menschen recht getan, ist eine Kunst, die niemand kann.
(Deutsches Sprichwort)

von Kerstin Bamminger | Okt. 10, 2025 | Allgemein, Leben
Bildquelle: newsbreak.com
Kein Weg führt derzeit an ihr vorbei. Egal, ob man bei ihrer Musik lieber am Absatz kehrt macht oder längst dazu singt, tanzt und vibed – Taylor Swift ist ein Phänomen unserer Zeit, das kaum jemand ignorieren kann. In ihrem neuen Album „Life of a Showgirl“ stecken tiefe Lebenslektionen über Selbsttreue, Mut und Liebe. Zeit, genauer hinzuhören – und hinzuspüren.
„Ihre Konzerte haben einen therapeutischen Effekt“ betonen Fans – nicht nur, weil die von ihr gefüllten Räume (oder eher Stadien) ein Safe Space für Frauen, junge Mädels und die LGBTQAI+ Community sind, sondern weil vor allem ihre Texte heilsam wirken können.
Wie kaum einer anderen gelingt es Taylor Swift, emotionale Höhen und Tiefen auf sehr nahbare, bodenständige und verständliche Weise in ihrer Musik zu verarbeiten.
Sie positioniert sich als „eine von uns“ und das Mädchen, das nie cool genug war und öffnet die Tore zu ihren sehr persönlichen angenehmen und schmerzhaften Erfahrungen im Leben und macht sich damit angreifbar. Obwohl man ihr das in der Laufbahn mehrmals ausreden wollte, blieb sie ihrer Linie beim Storytelling treu. Stilistisch beweist sie dagegen Vielfältigkeit, wenn man mehr hört als nur ihre Radionummern.
Ich gestehe: ich bin etwas „late to the Party“. Obwohl ihre Karriere schon über zwei Jahrzehnte dauert, wurde ich erst Anfang der 20er Jahre durch unsere Töchter auf sie aufmerksam. Bis dahin kannte ich Namen und die gängigen Nummern, die im Radio laufen. Welches Universum sich mir eröffnete, als ich langsam und sicher ein Swiftie (so bezeichnen sich die Fans von Taylor Swift selbst) wurde, ist schwer zu beschreiben. Ihr beachtlicher Lebensweg füllt nicht nur Wikipediaseiten, Musikgeschichtsbücher und Social Media Plattformen. Besonders die Texte sind komplex, literarisch und vielschichtig und daher sogar Inhalt universitärer Vorlesungen, Studien und Untersuchungen, um das Phänomen besser zu verstehen.
Aus meiner Sicht als psychologische Beraterin steckt auch das neue Album wieder voller wertvoller Lektionen. In diesem Blog stelle ich dir gern eine aus jedem Song zur Verfügung.
Lass uns loslegen.
The Fate of Ophelia –
Bleib dir selbst treu, dann kommen die richtigen Menschen in dein Leben.
Zwei zentrale Botschaften werden in diesem Songtext vereint: einerseits, dass ich mir selbst die Treue schwören und zu mir selbst stehen darf. Andererseits, dass wir ein Gegenüber brauchen – sei es eine romantische Liebesbeziehung oder eine andere tragfähige zwischenmenschliche Verbindung – um nicht in unserer Schwermütigkeit, Melancholie und Einsamkeit zu ertrinken.
Wie die gute alte Ophelia in Shakespear‘s Hamlet.
Lyric: „ I swore my loyalty to me, myself and I before you lit my sky up.“
Elizabeth Taylor –
Dein Licht wird die richtigen Menschen mit-aufblühen lassen.
Die Hollywood Ikone, deren Leben erstaunlich viele Parallelen mit Swift aufweist ist Namensgebern für das zweite Lied. Gefeiert und gleichzeitig tragische Heldin ihrer Zeit ist es oft schwer, einen dauerhaften Lebensgefährten zu finden – besonders, wenn man eine kluge, erfolgreiche und charakterstarke Frau ist.
Taylor Swift lässt uns in diesem Song jedoch wissen, dass die richtige Person an der Seite nicht vom Erfolg eingeschüchtert oder verjagt wird, sondern darin ebenfalls aufblüht und alles von Herzen gönnen kann, was das Gegenüber erreicht. Sollte längst normal sein. Ist es für viele Frauen leider nicht.
Lyric: „All the right guys promised they‘d stay. Under bright lights, they withered away, but you bloom.“
Opalite –
Lerne, im Regen und durch die Stürme zu tanzen.
Ein hellblau strahlendes, synthetisches Opalglas ist namensiebend für den dritten Titel und beschreibt, wie man sich aus dunklen Nächten und Lebensphasen herausmanövrieren kann. Mann müsste selbst für den Sonnenschein im Leben sorgen, wenn man eigentlich gerade zwischen den Gewitterblitzen tanzt, singt Taylor. Dabei betont sie auch, dass Fehler zu machen sehr viel Freiheit schenkt und man Resilienz und Widerstandsfähigkeit eben nur lernt, wenn man auch im Regen tanzen kann.
Lyric: „It’s alright. You were dancing through the lightening strikes.“
Father Figure –
Deine Geschichte, deine Erfolge & Erfahrungen: alles gehört DIR allein.
Sorgfältig bei George Michael’s Familie nachgefragt, ob sie die Textzeile verwenden darf, besingt Taylor in diesem Lied, wie wichtig es ist, die eigene Geschichte, den eigenen Erfolg und die eigene Kraft inne zu haben. Sie selbst hat sich in einem erbitterten Rechtsstreit mit ihrem ehemaligen Plattenlabel die Musikrechte ihrer ersten Alben teuer zurück gekauft, nachdem sie über den Tisch gezogen worden war. Ihre Botschaft ist klar: lass dir von niemandem auf der Welt dein Lebenswerk absprechen, sei stolz darauf und beschütze es, wie deine Familie.
Lyric: „You pulled the wrong trigger. This empire belongs to me. Leave it with me. I protect the family.“
Eldest Daughter –
Wie du zart bleiben kannst in einer beinharten Welt.
Traditionell platziert Taylor als fünften Song einen, der besonders emotional für sie ist. Es geht um die Rolle der Erstgeborenen, die meist extrem leistungsorientiert, verantwortungsvoll und überangepasst durch das Leben geht, um ja niemanden zu enttäuschen. Als älteste Tochter leidet sie selbst darunter, nicht cool und abgebrüht genug zu sein. Und dass in Kommentarspalten so oft ein unfassbar rauher Ton herrscht, der uns zwingt, ein dickes Fell anzulegen. Sie appelliert, die sanfte Seite zu bewahren, an die Liebe zu glauben und sich nicht von Verrätern und Schauspielern täuschen zu lassen.
Lyric: Every eldest daughter was the first lamb to the slaughter, so we all dressed up as wolves and we looked fire.“
Ruin the friendship –
Das Leben ist zu kurz für irgendwann.
Was sich zerstörerisch anhört ist ein Lied, das Mut machen soll. Taylor Swift plädiert dafür, nicht so viel zu hinterfragen, sondern einfach mal zu riskieren und: Fragen zu stellen, Dinge zu sagen oder die Freundschaft mit dem süßen Schulkollegen zu opfern, weil man herausfinden will, ob daraus mehr hätte werden können.
Auf berührende Weise erzählt sie, dass man für manche Dinge nicht ewig Zeit hat. Und lieber aufstehen, ausprobieren und raushauen soll, was einem am Herzen liegt.
Lyric: „My advice is always to answer the question. Better than ask it all your life.“
Actually romantic –
Verwandle deine Neider in bewundernde Fans.
Definitiv kein Liebeslied, das sich hinter Song Nummer 7 versteckt. Es geht darum, dass wir einen bemerkenswerten Perspektivwechsel einnehmen dürfen, wenn wir drauf kommen, dass Menschen hinter unserem Rücken schimpfen, schlecht reden oder zu allem was wir tun und lassen eine (verfechtbare) Meinung haben.
Taylor meint: hey, das ist eigentlich ganz schön viel Wertschätzung, Zuneigung und Liebe, wenn man sich überlegt, wie viel Zeit und Energie da manche hineinstecken. Also: nimm den Klatsch und Tratsch über dich von anderen und verwandle ihn in ein Kompliment für – weil du es ihnen wert bist, über dich zu reden.
Lyric: „It‘s actually sweet, all the time you‘ve spent on me.“
Wish List –
Du darfst dir wünschen, was du willst – ich bevorzuge das einfache Leben.
Ein Lied über alles mögliche, was Menschen sich für ein zufriedenes Leben wünschen. Die erstaunliche Erkenntnis einer Person, die fast alles erreicht hat und unermesslich reich ist: sie wünscht sich einen Partner mit dem sie „ein paar Kinder“ bekommen (die aussehen sollen wie er) und in der Einfahrt Basketball spielen kann. Auch wenn sie jedem Mensch gönnt, was immer er sich wünscht: sie freut sich auf ein einfaches Leben abseits vom Rampenlicht – weil es das ist, was wirklich zählt.
Lyric: „We tell the world to leave us the fuck alone and they do. Wow.“
Wood –
Wir sind selbst für unser Glück verantwortlich.
Definitiv der würzigste Song auf dem Album. Zweifellos geht es um ihren Verlobten Travis, aber auch um Aberglauben und die Erkenntnis, dass weder schwarze Katzen noch Sternschnuppen oder gekreuzte Finger das Glück in dein Leben schwemmen werden.
Wir selbst sind für unsere Wünsche zuständig und brauchen dafür nicht auf Holz klopfen – sondern einfach losgehen und zusammen mit viel Liebe den eigenen Lebenstraum verwirklichen.
Lyric: „Seems to me that you and me we make our own luck.“
Cancelled! –
Richtige Freunde stehen durch dick und dünn zu dir.
Menschen, die kontroverse Ansichten vertreten und öffentlich dafür aufstehen, werden heutzutage vor allem online kollektiv boykottiert. Neudeutsch nennt man das „Cancelled“ oder „cancle culture“. Wenn man mit dem Strom schwimmt ist es leichter, gemocht zu werden.
Taylor mahnt jedoch zur Vorsicht – oft sind das nicht die wahren Freunde. Diese erkennt man daran, dass man niemals zu viel für sie ist. Oft haben sie auch ähnliche Verletzungen davon getragen wie man selbst.
Lyric: „At least you know exactly who your friends are: they’re the ones with matching scars.“
Honey –
Der Ton macht die Musik – und zwar in jedem Wort, das wir sagen.
„Der Ton macht die Musik“ übersetzt wohl am einfachsten, was Taylor im vorletzten Lied transportieren will. Wenn jemand „Süße“ zu dir sagt, kann das je nach Tonfall vor Herabwürdigung triefen oder dir eine angenehme Gänsehaut bescheren.
Wenn du gelernt hast, dass Menschen dich mit bestimmten Kosenamen abwerten und kleinmachen wollen, kannst du in neuen Lebensphasen und mit anderen Personen überschreiben, wie Worte auf dich wirken.
Die 7-38-55 Regel, besagt, dass eine Nachricht zu 7% durch verbale Elemente (die gesprochenen Worte), zu 38% durch paraverbale Elemente (Stimmton, Lautstärke) und zu 55% durch nonverbale Elemente (Körpersprache, Gestik, Mimik) bestimmt wird. Taylor unterstreicht mit „Honey“ exakt diese Feststellung.
Lyric: „And when anyone called me „lovely“ they were finding ways not to praise me, but you say it like you‘re in awe of me.“
The life of a showgirl –
Lebe dein Leben und frag nicht um Erlaubnis.
Stars werden für ihren Lebensstil bewundert und beneidet. Im letzten Lied gibt es auch wieder zwei Botschaften zum Mitnehmen. Erstens: das öffentliche Leben ist mehr als Glitzer und Glamour, es ist auf seine eigene Art ziemlich heftig und nix für zart besaitete Seelen.
Zweitens: lass dich trotzdem von niemandem abschrecken für deine Träume loszugehen, wenn du spürst, dass das das richtige für dich ist.
Lyric: „I’d sell my soul to have a taste of a magnificent life, that’s all mine.“
Falls ich dir nun Lust gemacht hab, in das Album hinein zu hören: fein. Wenn nicht, ist auch alles gut. Ich bleib fasziniert von der Karriere, dem Wirken und den vielen Talenten der Taylor Swift. Freu mich darauf, ihre Musik als Lebensbegleitung, Untermalung und Bestärkung zu haben und auf all die verrückten, spielerischen und ausgeklügelten Ideen, Rätsel und Spekulationen in der Welt der Swifties.
Letztlich wünsche ich mir, dass wir verstehen: Taylor Swift ist für mich die personifizierte Antithese zum Patriarchat und lebt in vielerlei Hinsicht das vor, was Feminismus und gleiche Rechte für alle Menschen zum Ziel haben sollten. Vor allem hat sie eine Gemeinschaft kreiert, die neben ihrer Musik vor allem Zusammenhalt, Freundlichkeit und Offenherzigkeit feiert.
Und davon können wir ganz bestimmt alle ein gutes Stück vertragen.
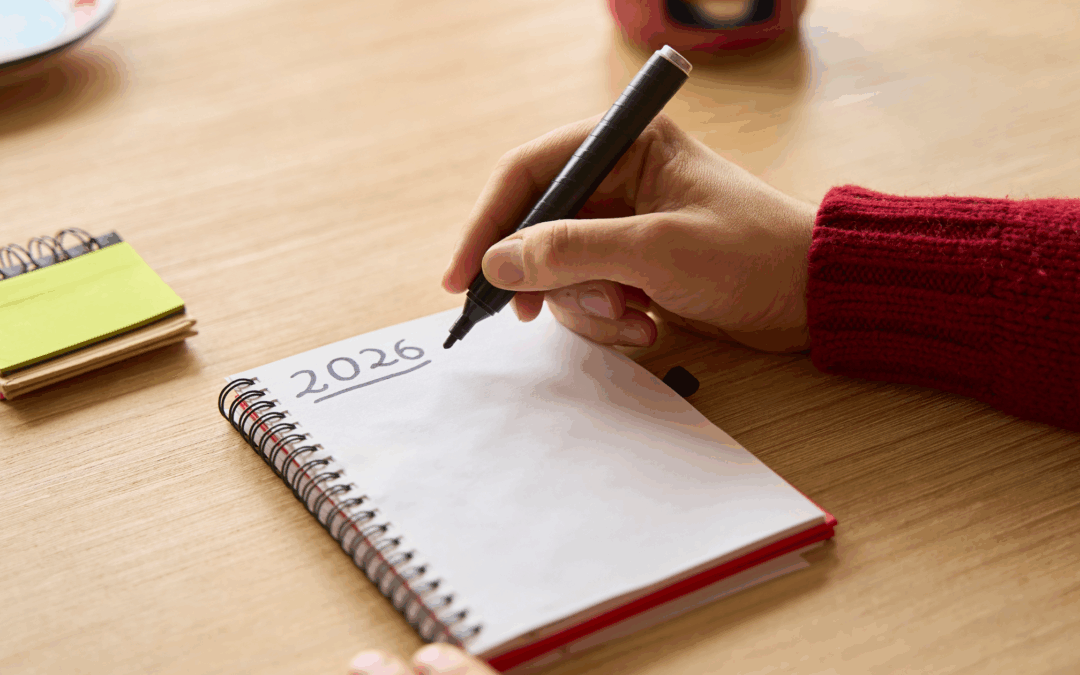



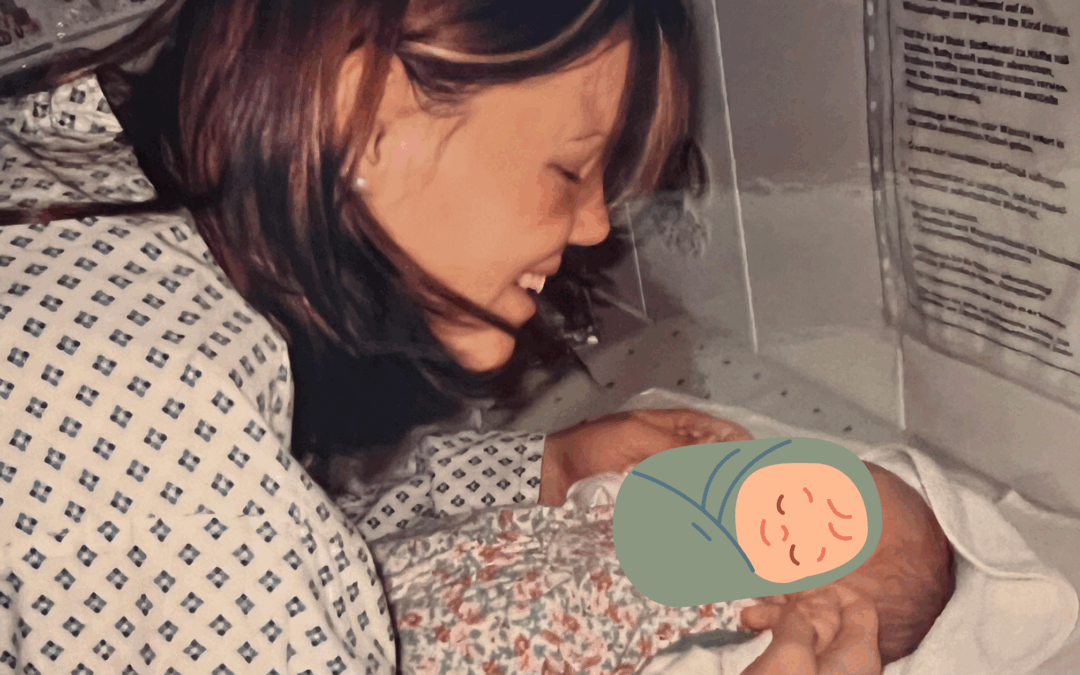


Neueste Kommentare